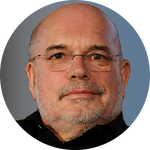Zentrale IG-Themen im 1.. Quartal 2025
Im 1. Quartal 2025 wurde die Diskussion zu Internet Governance von den folgenden fünf Themen bestimmt:
· Die Vorbereitung des 20. IGF in Oslo
· Die WSIS+20-Überprüfungskonferenz
· Künstliche Intelligenz (KI) und Verhandlungen zu den neuen KI-Gremien der UNO
· Der Fortgang der Verhandlungen zu Cybersicherheit
· Der Konflikt zwischen den US und der Europäischen Kommission zur Digitalpolitik
Internet Governance Forum
Die Vorbereitungen für das 20. UN Internet Governance Forum (IGF) in Oslo (23. – 27. Juni 2025) haben im 1. Quartal 2025 zügig begonnen.[1] Es gab mehrere virtuelle Meetings der neu formierten Multistakeholder Advisory Group (MAG) unter Leitung der Digitalministerin von den Bahamas, Carol Roach, und dem Leadership Panel (LP) unter Leitung von Friedensnobelpreisträgerin Maria Ressa und Vint Cerf, sowie dem norwegischen Gastgeber.[2]
Als Generalthema für das Osloer IGF wurde festgelegt: Building Digital Governance Together. Die Unterthemen sind: Digital Trust and Resilience; Sustainable and Responsible Innovation, Universal Access and Digital Rights und Digital Cooperation. Der „Call for Proposals“ für Workshops brachte über 500 Vorschläge. Die Evaluierung der Vorschläge erfolgt durch das MAG. Das Programm wird bei den 2. Open MAG Consultations vom 14. bis 16. April 2025 in Genf beschlossen. Es gibt wieder einen „Parliamentarian Track“ zu dem der stellvertretende UN-Generalsekretär und der Generalsekretär der Internationalen Parlamentarischen Union (IPU) gemeinsam mit dem Präsidenten des norwegischen Parlaments (Storting) eingeladen haben. [3]
Das Mandat des IGF endet am 31. Dezember 2025. Es liegt in den Händen der WSIS+20-Überprüfungskonferenz, wie es mit dem IGF weitergeht. Nachdem im September 2024 der Global Digital Compact (GDC) in Artikel 28 das IGF als „the primary multi-stakeholder platform for discussion of Internet governance issues“ anerkannt hat, wird allgemein erwartet, dass das IGF-Mandat um weitere zehn Jahre verlängert wird. Es gibt auch Vorschläge, das IGF zu einer permanenten Institution zu machen. Für 2026 und 2027 haben sich jedoch noch keine Kandidaten beworben.
Auch das Mandat des IGF Leadership Panel (LP) endet am 31. Dezember 2025. Bei zwei gemeinsamen virtuellen Sitzungen zwischen MAG und LP im Februar und März 2025 wurden mittel- und langfristige Perspektive diskutiert. Beim IGF in Oslo soll die LP-Initiative „The IGF We Want“[4] und das Dokument “The Internet We Want“[5] in einer Plenarsitzung diskutiert werden.
· Der Vorschlag des LP-Co-Chairs, Vint Cerf, dem IGF einen permanenten Status zu verleihen, erhielt breite Zustimmung. Eine Veränderung des Mandats (Artikel 72 der Tunis Agenda) sei dafür nicht nötig, wohl aber eine stabilere personelle und materielle Ausstattung des IGF-Sekretariats in Genf. Notwendig sei auch eine Koordinierung mit dem GDC Follow Up. Wird das Mandat das IGF verlängert, muss es eine Neubesetzung des LP geben.
· Rückblickend hat sich gezeigt, dass die Entscheidung von 2023, mit dem LP eine kleine Leitungsgruppe mit lediglich 15 Personen ohne Exekutivgewalt zu etablieren, richtig war. Sie hat dem IGF-Prozess neuen Schwung und größere internationale Wahrnehmung gebracht hat. Die befürchtete Konkurrenz mit dem MAG hat es nicht gegeben. Im Gegenteil, zwischen MAG und LP hat sich eine produktive Kooperation entwickelt. Die Schwäche des LPs bestand allerdings darin, dass einige der zehn vom UN-Generalsekretär Guterres berufenen Mitglieder nur sporadisch an der LP-Arbeit teilgenommen haben.
WSIS+20-Überprüfungskonferenz
Am 25. März 2025 verabschiedete die 79. UN-Vollversammlung (UNGA) mit der UN-Resolution 79/277 die Modalitäten für die Überprüfungskonferenz des UN-Weltgipfels zur Informationsgesellschaft (WSIS+20). Evaluiert werden die Umsetzung der WSIS-Prinzipiendeklaration und der WSIS-Aktionsplan von Genf (2003) sowie die Tunis Agenda (2005).
Nach der UN-Resolution 79/277 soll der Evaluierungsprozess in eine zweitägige hochrangige Regierungskonferenz am 16. und 17. Dezember 2025 in New York münden. Dort soll ein „intergovernmental agreed outcome document“ verabschiedet werden. Das soll die Weichen für die Entwicklung internationaler Digitalpolitik für die nächsten zehn Jahre (WSIS+30) stellen. Die Konferenz soll durch einen eigenständigen „intergovernmental preparatory process“ im Rahmen der 80. UN-Vollversammlung (UNGA) vorbereitet werden. Dieser Prozess wird von zwei „Co-Facilitators“, die vom Präsidenten der UNGA benannt werden, geleitet. Grundlage der Verhandlungen wird der Bericht der UNCSTD sein, der bei der 28. UNCTSD-Tagung im April 2025 in Genf diskutiert werden wird und zu dem die mehr als 30 in der UNGIS (United Nations Group in the Information Society) vertretenen UN-Organisationen zugearbeitet haben. Der „intergovernmental preparatory process“ soll auch „Input“ von allen relevanten WSIS-Stakeholdern berücksichtigen. Nach Artikel 3 der UN-Resolution 79/277 sollen nicht-staatliche Vertreter bei der Abschlusskonferenz im Dezember 2025 in New York angemessen zu Wort kommen.
Trotz vieler Diskussionen und Vorschläge im Vorfeld der Annahme der UN-Resolution 79/277 bleibt offen, wie die Interaktion zwischen dem Verhandlungsprozess der Regierungen und den Aktivitäten nicht-staatlicher Stakeholder praktisch organisiert werden soll. Nach Artikel 5 der UN-Resolution 79/277 sind es die Co-Facilitatoren, die die Regierungsverhandlungen bis zum Abschlussdokument führen. Davon abgehoben sollen nach Artikel 6, „informelle interaktive Konsultationen mit allen relevanten Stakeholdern“ stattfinden. Die werden vom Präsidenten der UNGA anberaumt. Eer soll dort „Input“ einsammeln für die zwischenstaatlichen Verhandlungen. Es bleibt aber unklar, wie dieser „Input“ in die Regierungsverhandlungen einfließt. Unklar ist weiterhin, ob auch die Co-Facilitatoren verpflichtet sind, Multistakeholder-Konsultationen durchzuführen und ob nicht-staatliche Stakeholder Zugang zu den zwischenstaatlichen Verhandlungen haben.
· In einem „Five-Point Plan for an Inclusive WSIS+20 Review“[6] haben am 26. März 2026 über 100 NGOs konkrete Vorschläge gemacht, wie eine Interaktion zwischen Regierungen und nicht-staatlichen Stakeholdern aussehen könnte. Stakeholder sollten von Anfang an in die Ausarbeitung von Entwürfen des WSIS+20-Abschlussdokuments einbezogen werden, es sollte Möglichkeiten für Kommentierungen zu Zwischenentwürfen im gesamten Verhandlungsprozess geben und bei der hochrangigen Abschlusskonferenz im Dezember 2025 in New York müssen alle Stakeholder vertreten sein. Die im April 2024 von der NetMundial+10 Konferenz verabschiedeten „São Paulo Multistakeholder Guidelines“ (SPMGs)[7] enthalten weithin anerkannte konkrete Prozeduren, wie ein effektives Zusammenwirken aller Stakeholder organisiert werden kann.
· Bereits am 12. Februar 2025 hatte die Freedom Online Coalition (FOC) vier Vorschläge zu den WSIS+20-Prozeduren unterbreitet: 1. Preserve and enhance the multistakeholder model of digital policymaking by ensuring that all stakeholders have a meaningful voice in the WSIS+20 negotiations. 2. Advocate for a long-term or permanent extension of the Internet Governance Forum (IGF) and strengthen its institutional capacity. 3. Seek to have GDC implementation done within the WSIS ecosystem to avoid duplication. 4. Reinforce that digital inclusion was at the heart of the WSIS and continues to be a priority as digital inequality persists.“[8]
· Auch die deutsche IGF-D Community äußerte sich in einem Brief vom 18. März 2025 an die deutsche UN-Botschafterin Leendertse zum WSIS+20-Prozess. In diesem Brief wird die aktive Beteilung nicht-staatlicher Stakeholder, die Weiterentwicklung des Multistakeholder Modells und die Verlängerung des IGF-Mandats gefordert. Darüber hinaus wird vorgeschlagen, dass WSIS+20 die zukünftige Umsetzung der elf WSIS-Aktionslinien enger mit den 16 nachhaltigen Entwicklungszielen der UNO (SDGs) verbinden soll.
Offen ist, inwieweit sich die veränderte Weltlage auf die WSIS+20-Konferenz auswirken wird. Es steht zu erwarten, dass WSIS+20 die neuen geopolitischen Kontroversen spiegeln wird.
· Der „globale Süden“ wird neben Anstrengungen zur Überwindung der digitalen Spaltung und größerem finanziellen Engagement beim Ausbau der digitalen Infrastruktur eine stärkere Teilhabe bei der Datenwirtschaft und der Entwicklung von KI einfordern. Bei einem BRICS Expertenseminar am 18. März 2025 forderte z.B. der brasilianische Digitalminister Luis Felipe Giesteira, dass es unakzeptabel sei, dass Entwicklungsländer zum Lieferanten von Rohdaten würden, während die darauf aufbauenden Dienste von den westlichen Staaten entwickelt würden.[9] Dieses Thema steht bereits auf der Tagesordnung der vom GDC neu gegründeten UNCSTD Working Group on Data Governance, die im April 2025 in Genf ihre Arbeit aufnimmt. Es wird nachhaltig WSIS+20 beeinflussen. [10]
· Unklar ist auch die Rolle der USA. In einer Diskussion im ECOSOC in New York zum Tag der friedlichen Koexistenz am 5. März 2025 hatte Edward Heartney, Diplomat der amerikanischen UN-Botschaft, ein bemerkenswert negatives Statement zu den nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO (SDGs) abgegeben: „Die SDGs fördern ein Programm der sanften Global Governance, das mit der Souveränität der USA unvereinbar ist und den Rechten und Interessen der Amerikaner zuwiderläuft. Bei den letzten US-Wahlen war der Auftrag des amerikanischen Volkes eindeutig: Die US-Regierung muss sich wieder auf die Interessen der Amerikaner konzentrieren. Präsident Trump hat auch eine klare und überfällige Kurskorrektur in Bezug auf die „Gender“- und Klimaideologie vorgenommen, die die SDGs durchdringen. Einfach ausgedrückt: Globalistische Bestrebungen wie die Agenda 2030 und die SDGs haben an der Wahlurne verloren. Daher lehnen die USA die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung ab.“[11] Was das für WSIS+20 heißt, bei denen es ja u.a. darum geht, die WSIS-Aktionslinien mit den SDGs zu verbinden, ist unklar.
· Russland wird bei WSIS+20 möglicherweise die Frage der staatlichen Kontrolle des Internet aufwerfen. In der UN-Resolution 79/194 „ICT for Development“ vom 29. Dezember 2024 ist die seit der Tunis Agenda von 2005 strittige Formel von „Enhanced Cooperation“ wieder aufgetaucht. In Tunis wurde mit dieser mehrdeutigen Formulierung der Dissens über die Schaffung einer zwischenstaatliche Organisation für das Internet überbrückt. Die beiden „UNCSTD Working Groups on Enhanced Cooperation“ (WGEC), die sich zwischen 2014 und 2019 damit befassten, blieben ergebnislos. In den letzten Jahren hat Russland versucht, über eine ITU Council Working Group (CWG-Internet) entsprechende Vorschläge zu lancieren, was gleichfalls fehlschlug. Auch die Bewerbung Russlands, 2025 das IGF in St. Petersburg auszutragen, scheiterte. Es wäre nicht überraschend, wenn Russland die WSIS+20-Verhandlungen zum Anlass nehmen würde, um z.B. die Forderung nach einem „Governmental Oversight Committee“ (GOC) über ICANN an eine Verlängerung des IGF-Mandats zu binden.
· China hat sich in den kontroversen Diskussionen zur global Digitalpolitik in den letzten Jahren zurückgehalten und sich als ein Unterstützer des globalen Südens profiliert. China hat wenig Interesse an der Gründung eines neuen zwischenstaatlichen UN-Internet-Gremium gezeigt. Die Cyberadministration of China (CAC), die direkt dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping untersteht, hat sich bei den letzten IGFs mit eigenen Workshops konstruktiv engagiert. Im September 2020 hatte der chinesische Außenminister Wang in der UNO eine „Global Data Security Initiative“[12] eingebracht, die bislang allerdings folgenlos blieb. Bei der 78. UN-Vollversammlung hat China eine KI-Resolution zu „AI Capacity Building“ in Entwicklungsländer[13] (UN-Resolution 78/311 vom 5. Juli 2024) eingebracht, die große Unterstützung, einschließlich von Seiten der USA, erhielt.[14]
Künstliche Intelligenz
Die Debatte zu künstlicher Intelligenz setzte sich im 1. Quartal 2025 auf verschiedenen Ebenen fort. Wichtigste Schauplätze waren der KI-Gipfel in Paris (Februar 2025) und die in New York beginnenden Verhandlungen zur Umsetzung der Beschlüsse des Global Digital Compact (GDC) für ein „International Scientific Panel on AI“ und einen „Global Dialogue on AI Governance“ unter dem Dach der UNO. Das Thema wird zunehmend auch bei hochrangigen politischen Konferenzen wie dem Davoser Weltwirtschaftsforum (Januar 2025) oder der Münchner Sicherheitskonferenz (Februar 2025) diskutiert.
Der KI-Gipfel in Paris (11. und 12. Februar 2025) war der dritte KI-Gipfel des sogenannte „Bletchley-Prozesses“ den die britische Regierung 2023 gestartet hatte, um einen hochrangigen KI-Dialog zwischen Regierungen und KI-Unternehmen zu etablieren. Ein zweiter KI-Gipfel fand 2024 in Seoul statt, bei dem KI-Sicherheit im Mittelpunkt stand. Dort wurde das Konzept nationaler und regionaler „AI Safety Institutes“ entwickelt.
· Am Pariser KI-Gipfel, der von Frankreichs Präsidenten Emanuel Macron eröffnet wurde, nahmen über 1000 Experten aus mehr als 100 Ländern teil, darunter der amerikanische Vizepräsident J.D. Vance, Indiens Premierminister Modi und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Erstmalig wurden die Themen „KI und Energie“ sowie „KI und Arbeitsmarkt“ besprochen.
· 61 Regierungen unterzeichneten ein „Statement on Inclusive and Sustainable Artificial Intelligence for People and the Planet“.[15] Die Erklärung stärkt das Multistakeholdermodell für KI-Governance, begrüßt den Ausbau der beim 2. KI-Gipfel in Korea beschlossenen „AI Safety Institutes“ und unterstützt die UN-Initiativen für einen globalen KI-Dialog und ein internationales KI-Panel, bleibt aber sonst in seiner Allgemeinheit hinter den Gipfelerklärungen von London (2023) und Seoul (2024) zurück.
· Das Statement zeichneten alle EU-Staaten, viele Entwicklungsländer und China. Die USA und Großbritannien zeichneten das Dokument nicht.[16] Am Vorabend des Pariser KI-Gipfels hatte US-Präsident Trump die Executive Order (EO) zu KI seines Vorgängers Joe Biden außer Kraft gesetzt und verkündet, dass sich amerikanische KI-Unternehmen keinen Beschränkungen unterwerfen werden. US-Vizepräsident J.D. Vance pries in seiner Pariser Rede die US-KI als „Golden Standard“ für die Welt und kritisierte scharf die europäische KI-Gesetzgebung: „The US will ensure that US AI technology continues to be the gold standard worldwide and we are the partner of choice for others, as they expand their own use of AI. We believe that excessive regulation of the AI could kill a transformative industry just as it's taking off. And we feel strongly that AI must remain free from ideological bias. American AI will not be co-opted into a tool for authoritarian censorship“.[17]
· 10 Staaten (Chile, Finnland, Frankreich, Kenia, Marokko, Nigeria, Slowenien, Schweiz, Deutschland und Indien) unterzeichneten separat eine „Paris Charter on Artificial Intelligence in the Public Interest“[18] und begründeten eine neue „Public Interest AI Platform“ (PIAP). Die „Paris Charter“ verweist auf die ungleiche Verteilung von KI-Kapazitäten in der Welt und die Gefahr einer neuen „AI Divide“. Benannt werden Risken eines Missbrauchs von KI und die Gefahren von Markkonzentrationen. „The benefits of AI in the public interest rely on building open public goods and infrastructure, providing an alternative to existing market concentration.“ Die neue PIAP-Plattform soll die vielen unübersichtlich gewordenen KI-Initiativen besser koordinieren und mehr Entwicklungsländer mittels Capacity Building und Austausch von „best practice“ in die Diskussion einbeziehen. Unklar bleibt, wie diese neue PIAP-Initiative mit der OECD Global Partnership on AI (GPAI) koordiniert wird.[19]
Die Verhandlungen zur Schaffung der vom GDC beschlossenen zwei neuen UN-KI-Gremien - „International Scientific Panel on AI“ und „Global Dialogue on AI Governance“ – wurden mit mehreren Regierungs- und Stakeholder-Konsultationen begonnen, bei denen es um Mandat, Strukturen und Arbeitspläne ging.
· In einem „Elements Paper“ vom 28. Februar 2025 wurden erste Grundzüge für beide Institutionen zusammengefasst. Das KI-Panel soll „unabhängig, multidisziplinär und global“, der KI-Dialog sowohl „multistakeholder“ als auch „multilateral“ sein und Synergien zu anderen Initiativen nutzen.
· Basierend auf den Februar-Konsultationen legten am 18. März 2025 die Ko-Koordinatoren (Costa Rica & Spanien) einen Zero Draft vor, der bereits präziser die Elemente der beiden neuen Institutionen beschreibt.
o Das KI-Panel soll aus einem „Expert Committee“ (20 Mitglieder), benannt vom UN-Generalsekretär, sowie einem „Advisory Committee“ (40 Mitglieder), gewählt von der UN-Vollversammlung, bestehen. Neben Einzelstudien zu diversen Spezialthemen soll das KI-Panel jährlich einen „AI World Report“ erarbeitetet.
o Der KI-Dialog soll in Verbindung mit einer UN-Organisation (ITU, UNESCO, IGF) stattfinden. Der erste KI-Dialog ist für September 2025 in New York, der zweite für 2026 in Genf geplant.
Bei akademischen und politischen Konferenzen zu KI fällt auf, dass die Rolle von künstlicher Intelligenz in der militärischen Domain immer stärker ins Blickfeld rückt. Die KI-Verhandlungen zwischen Regierungen, z.B. bei der UNESCO, im Europarat, in der EU, in der OECD oder im Bletchley-Prozess, wurde die militärische Dimension expressis verbis ausgeklammert. Militärische Aspekte wurden separat seit 2012 in der GGE LAWS und seit 2023 in der UN-Vollversammlung verhandelt. Angesichts der Entwicklungen in aktuellen Kriegen scheint diese Trennung obsolet zu werden.
· Die niederländische Regierung hat über das Zentrum für strategische Studien (HSSC) in Den Haag eine „Global Commission on Responsible Artificial Intelligence in the Military Domain (GC REAIM) ins Leben gerufen[20] mit dem Mandat „to help promote mutual awareness and understanding among the many communities working on issues related to the global governance of AI in the military domain.“ Vorsitzender ist der ehemalige koreanische Außenminister Byung-se Yun. Die GC REAIM hat 19 Mitglieder sowie 31 Berater aus 35 Ländern, darunter einige frühere Generäle. Ein Abschlussbericht soll im Sommer 2026 vorliegen.
· Im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz hat sich eine „Münchner Cybersicherheitskonferenz“ (MCSC) als eigenständige Konferenz entwickelt, bei der im Februar 2025 die militärische KI-Nutzung, z.B. im Ukraine Krieg, eine große Rolle spielte.[21]
· Das Weltwirtschaftsforum in Davos (WEF) veröffentliche am 3. März 2025 einen Bericht „AI red lines: the opportunities and challenges of setting limits“[22] in dem sich für „rote Linien“ bei der Entwicklung von KI ausgesprochen wird. „Behavioural red lines are necessary to ensure AI remains in accordance with societal norms. Red lines govern both harmful uses of AI by humans and harmful autonomous behaviour by AI systems“. Bereits beim WEF im Januar 2025 wurde in Davos über autonome Waffen und Drohnen diskutiert. Ein WEF-Bericht „AI in Action: Beyond Experimentation to Transform Industry“[23] lieferte dazu einen neuen Ansatz. Die 2023 gegründete „WEF AI Governance Alliance“[24] hat sich jedoch noch nicht mit militärischen Aspekten befasst.
· Das „Oxford Internet Institut“ (OII) hat im Februar 2025 anlässlich der Publikation des Buches „The Ethics of Artificial Intelligence in Defence“ von Mariarosaria Taddeo einen Workshop zu militärischer KI organisiert.[25]
· UNIDIR, das UN-Institut für Abrüstungsforschung in Genf, hat zu der militärischen Dimension von KI in den letzten Monaten mehrere Publikationen vorgelegt[26] und am 30. und 31. März 2025 eine hochrangige Expertenkonferenz in Genf veranstaltet.[27]
Cybersicherheit
Im Bereich Cybersicherheit waren im 1. Quartal 2025 insbesondere die vorletzte Sitzung der Open Ended Working Grouo (OEWG) in New York und die Frühjahrsitzung der Expertengruppe zu autonomen Waffensystemen (GGE LAWS) in Genf von Bedeutung. Bekanntgegeben wurde, dass die Zeremonie zur Unterzeichnung der im Dezember 2024 von der 79. UN-Vollversammlung verabschiedeten UN-Konvention gegen Cyberkriminalität im Juli 2025 in Hanoi stattfindet.
Bei der 10. OEWG-Tagung (10. – 17 Februar 2025) ging es primär um die weitere Etablierung des Point of Contact Mechanismus (POC), des sogenannten „roten Telefons“ für Cyberangriffe, sowie die Umwandlung der OEWG in eine permanente UN-Institution. Diskutiert wurde erneut die Einbeziehung von nicht-staatlichen Stakeholdern in die OEWG-Arbeit. Die letzte Sitzung der OEWG findet vom 7. – 11. Juli 2025 in New York statt. Der OEWG-Abschlussbericht geht dann an den 1. Ausschuss der 80. UNGA. Die muss über das weitere Vorgehen der UNO im Bereich von Cybersicherheit entscheiden. Das OEWG-Mandat endet am 31. Dezember 2025.
· Beim POC-Mechanismus wurden substantielle Fortschritte erzielt. Im März 2025 gab es mehrere praktische Tests (Simulation Exercises) zur Funktionsfähigkeit des neuen Mechanismus. Der Test wurde in Zusammenarbeit mit UNODA, UNIDIR und ITU durchgeführt. Daran beteiligten sich 130 POCs aus mehr als 80 Staaten.[28] Am 28. März 2025 wurde der Entwurf eines „Template for Communication“ veröffentlicht, der als Richtlinie für die neu zu errichtenden POCs gelten soll.[29]
· Die Diskussion zur Schaffung eines „Permanent UN Cybersecurity Mechanism“ hat noch nicht zu einem klaren Vorschlag geführt. Offen ist, ob dieser neue Mechanismus ein traditioneller UN-Ausschuss, vergleichbar mit dem UN-Weltraumausschuss, werden soll oder mehr ein Aktionsprogramm, das sich um die Umsetzung der 2015 vereinbarten elf Prinzipien für ein verantwortungsbewusstes Verhalten von Staaten im Cyberpace kümmert. Offen sind auch die inhaltlichen Schwerpunkte. In der Diskussion sind vier „Dedicated Thematic Groups“ zum Schutz kritische Infrastrukturen, zu vertrauensbildenden Maßnahmen, zur Anwendung des Völkerrechts im Cyberspace und zu Cyber Capacity Building.[30]
· Strittig ist nach wie vor die Frage, wie nichtstaatliche Stakeholder in die zukünftige Arbeit des permanenten Mechanismus einbezogen werden. Im Februar 2025 machten Canada und Chile, unterstützt von 27 Ländern, einen detaillierten Vorschlag, der sich grundsätzlich für eine Öffnung ausspricht. In dem Papier heißt es: „States recognize the valuable contributions of the multistakeholder community in multilateral cybersecurity discussions, especially considering their unique expertise and the technical reality of cyberspace. The multistakeholder community, including academia, civil society, the private sector, and the technical community are invited to meaningfully contribute within the future UN mechanism on cybersecurity.“[31]
Bei den GGE LAWS (3. – 7. März 2025 in Genf) wurden erstmals seit Jahren wieder Fortschritte erzielt. Zwar gibt es noch keinen Konsensus zu dem „Rolling Text“, der in fünf Kapiteln Elemente einer möglichen Vereinbarung umreißt. Zu drei der „Five Boxes“ wurde aber ein vereinbarter Text veröffentlicht.[32] Der Chair der GGE LAWS, der Niederländer Robert in den Bosch, zeigte sich aber optimistisch, bis zur Herbstsitzung im September 2025 zu den Schlüsselfragen - Definition von autonomen Waffensystemen (AWS), der Umsetzung von „human control“ und Geltung des humanitären Völkerrechts (IHL) beim Einsatz von AWS - Ergebnisse vorlegen zu können. UN-Generalsekretär Guterres drängt auf den Abschluss eines völkerrechtlichen Vertrages im Jahr 2026.
Kontroverse Digitalpolitik: USA vs. Europäische Union
Nachdem US-Präsident Trump am 21. Januar 2025 sein Amt angetreten hat, haben sich die Kontroversen zwischen den USA und der Europäischen Union im Bereich von Digitalpolitik verschärft. Trump sieht in dem von der EU in den letzten fünf Jahren erarbeiteten „Digital Rulebook“ (DSA, DMA, AI Act, DGA, NIS2, Data Act etc.) eine unakzeptable Behinderung von amerikanischen Tech-Unternehmen und droht mit Gegenmaßnahmen. Die EU zeigt sich von diesen Drohungen unbeeindruckt und setzt die Umsetzung der zahlreichen Digitalgesetze, einschließlich der Abmahnungsverfahren gegen US-Digitalkonzerne fort. Unklar ist die Zukunft des vor drei Jahren gegründeten US-EU-Trade and Technology Council (TTC)[33]. Der TTC sollten „compatible standards and regulations based on shared democratic values“ fördern. Unklar ist auch, ob die USA sich weiter an der Umsetzung der OECD/G20 Vereinbarung für eine globale Digitalsteuer (BEPS Pillar Two) beteiligen[34].
Die USA haben insbesondere bei zwei Anlässen ihre neue internationale Digitalstrategie deutlich gemacht: Erstens bei den Reden von US-Vizepräsident J.D. Vance beim KI-Gipfel in Paris und auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Beide mündeten in Frontalangriffen auf die europäische digitale Gesetzgebung. Zweitens im Memorandum „Defending American Companies and Innovators from Overseas Extortion and unfair Fines and Penalties“ vom 21. Februar 2025. Dort forderte US-Präsident Donald Trump Maßnahmen gegen die Bußgeldverfahren, die die Europäische Kommission gegen US Tech Konzerne eingeleitet hat.
· In seiner Rede beim KI-Gipfel Paris am 12. Februar 2025 sagte J.D. Vance: „The Trump Administration is troubled by reports that some foreign governments are considering tightening the screws on U.S. tech companies with international footprints. Now, America cannot and will not accept that, and we think it's a terrible mistake. The U.S. innovators of all sizes already know what it's like to deal with onerous international rules. Many of our most productive tech companies are forced to deal with the EU's DSA and the massive regulations it created about taking down content and policing so-called misinformation. For smaller firms, navigating the GDPR means paying endless legal compliance costs or otherwise risking massive fines. The AI future is not going to be won by hand-wringing about safety. It will be won by building the manufacturing facilities that can produce the chips of the future“.[35] Auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz (15. Februar 2025) griff J.D. Vance das DSA an: „Ich schaue nach Brüssel, wo die Kommissare der EU-Kommission die Bürger davor warnten, dass sie beabsichtigen, die sozialen Medien in Zeiten ziviler Unruhen zu schließen: in dem Moment, in dem sie etwas entdecken, das sie als „hasserfüllten Inhalt“ einstufen oder verdächtigt werden, im Internet frauenfeindliche Kommentare gepostet zu haben.“[36]
· Am 21. Februar 2025 unterzeichnete US-Präsident Donald Trump ein Memorandum mit dem Titel „Verteidigung amerikanischer Unternehmen und Innovatoren vor Erpressung und ungerechtfertigten Bußgeldern und Strafen in Übersee“. Das Memorandum verpflichtet u.a. das US-Wirtschaftsministerium (DOC) und den US-Handelsbeauftragten (USTR) zu untersuchen, inwieweit Regularien anderer Länder Freiheiten amerikanischer Internetunternehmen – also Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, X, Open AI & Co. – einschränken, und wie die USA dagegen vorgehen sollten. In dem Text heißt es: „Anstatt ihre eigenen Arbeitnehmer und Volkswirtschaften zu stärken, haben ausländische Regierungen zunehmend extraterritoriale Befugnisse über US-Unternehmen im Technologiesektor ausgeübt, die den Erfolg dieser Unternehmen behindern und sich Einnahmen aneignen, die zum Wohlergehen unserer Nation beitragen sollten, nicht zu ihrem“, heißt es in dem Dokument. Amerikas Tech-Unternehmen würden von der EU ausgeplündert. „Ausländische Regierungen werden zur Rechenschaft gezogen, wenn sie Schritte unternehmen, um US-Unternehmen zur Herausgabe ihres geistigen Eigentums zu zwingen. Regularien, die US-Unternehmen vorschreiben, wie sie mit Verbrauchern in der EU interagieren, wie der DMA und der DSA, werden von der Regierung unter die Lupe genommen.“ Solche Maßnahmen, heißt es bei Trump, „verletzen die amerikanische Souveränität und verlagern unsere Arbeitsplätze ins Ausland, schränken die globale Wettbewerbsfähigkeit von US-Unternehmen ein und erhöhen die Betriebskosten, während sie unsere sensiblen Informationen potenziell feindseligen ausländischen Aufsichtsbehörden preisgeben.“ Und er fügt hinzu: „Meine Regierung wird nicht zulassen, dass US-Unternehmen gescheiterte ausländische Volkswirtschaften durch erpresserische Geldstrafen und Steuern stützen. Amerikas Wirtschaft wird keine Einnahmequelle für Länder sein, die es versäumt haben, ihren eigenen wirtschaftlichen Erfolg zu kultivieren.“
Die Europäische Kommission hat auf die US-Drohungen gelassen reagiert. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz sagte die für Digitalpolitik zuständige EU-Vizepräsidentin Henna Virkkunen am 15. Februar 2025, dass die vom US-Vizepräsidenten J.D. Vance geforderte De-Regulierung des Digitalsektors keine Option für die EU sei. Man könne allenfalls über eine „Vereinfachung der Gesetzgebung“ (regulatory simplification) reden.
· Vor dem Hintergrund der Ankündigung von Marc Zuckerberg, das Meta nach dem Wahlsieg von Donald Trump die sogenannte „Content Moderation“ aussetzen wird, diskutierte das Europäische Parlament am 23. Januar 2025 die Zukunft des Digital Service Acts (DSA). Die Ankündigung der EU Vizepräsidentin Henna Virkkunen, nicht dem Druck der US-Konzerne nachzugeben, fand Unterstützung. „Was nutzt es uns, Gesetze zu haben, wenn wir nicht den Mut haben, sie anzuwenden?“ fragte der französische MEP Glucksmann.[37] Und die holländische Parlamentarierin van Sparrentak argumentierte: “A true free internet is one where not a small bunch of tech oligarchs, but our democratic institutions make the rules. In the current geopolitical context we cannot afford to be naive. The EU needs to stand strong and stand up for democracy online and offline. The push for deregulation in tech led by Trump and his friends will no longer bring us freedom and democracy, but further plummet us into a tech oligarchy"[38]. Virkkunen kündigte neue Verfahren gegen X, Facebook und TikTok an, will ihre Behörde personell aufrüsten und im November 2025 dem Parlament einen Fortschrittsbericht vorlegen.
· Am 13. Februar 2025 hat der Europäische Rat für digitale Dienste die Integration des freiwilligen Verhaltenskodex für Desinformation (Code of Practice on Disinformation)[39] in den DSA gebilligt. Damit wird der Kodex zum rechtsgültigen Maßstab für die Einhaltung des DSA durch die Plattformen. Die Liste mit den Very Large Online Platforms (VLOPS) und Very Large Search Engines (VLOSE) wurde von der EU-Kommission am 6. Februar 2025 aktualisiert. Die Liste enthält 20 Unternehmen, darunter AliExpress und TikTok aus China, Meta, Google, Amazon, Apple und Twitter aus den USA, aber auch Booking.com, LinkedIn, Wikimedia und das in Deutschland ansässige Zalando.[40] VLOPS and VLOSEs sind gegenüber der EU-Kommission berichtspflichtig. Am 19. März 2025 hat die EU-Kommission an Alphabet zwei sogenannte „Preliminary Findings“ geschickt und auf Verletzungen des DSA durch „Google Play“ und „Google Search“ aufmerksam gemacht. [41] Apple wurde wegen mangelnder Interoperabilität auf Verstöße gegen des DMA gerügt. [42]
· Auch die Arbeiten am „Code of Practice for General-Purpose AI“[43], ein Leitfaden für die Anwendung des EU-KI-Gesetzes, gehen ungebremst weiter. Am 25. März 2025 wurde der dritte Entwurf zur Diskussion gestellt. In den ersten beiden Abschnitten werden die Transparenz- und Urheberrechtsverpflichtungen detailliert beschrieben, wobei für Anbieter bestimmter Open-Source-Modelle im Einklang mit dem KI-Gesetz Ausnahmen vorgesehen sind. Der dritte Abschnitt ist nur für eine kleine Anzahl von Anbietern fortschrittlichster KI-Modelle relevant, die gemäß den Klassifizierungskriterien in Artikel 51 des KI-Gesetzes systemische Risiken darstellen könnten. Hier umreißt der Kodex Maßnahmen zur Bewertung und Abschwächung systemischer Risiken, einschließlich Modellbewertungen, Berichterstattung über Vorfälle und Cybersicherheitsverpflichtungen. Bis Mai 2025 soll der Code verabschiedungsreif sein.[44]
· Um unabhängiger von US-Tech-Konzernen zu sein, diversifiziert die EU ihre internationale Digitalpolitik. Im 1. Quartal betraf das insbesondere den Ausbau der der Beziehungen zu Indien und Südafrika.
o Am 28. Februar 2025 fand in New Delhi die zweite Sitzung des „EU-India Trade and Technology Council“ statt. Im Ergebnis wurde eine weitreichende KI-Kooperation vereinbart. Drei Arbeitsgruppen vertiefen Projekte zu Strategic Technologies, Digital Governance, and Digital Connectivity; Clean and Green Technologies sowie Trade, Investment and Resilient Value Chains. Beide Seiten vereinbarten auch bei Internet Governance enger zusammenzuarbeiten und unterstützen des Multistakeholder Modell: „Both sides agreed to collaborate on the implementation of the Global Digital Compact. ..They noted the need to ensure that the forthcoming WSIS+20 maintains global support for and enhances the multi-stakeholder model of Internet governance“.[45]
o Am 13. März 2025 fand in Kapstadt ein EU-Südafrika-Gipfel unter Leitung von Cyril Ramaphosa, Präsident von Südafrika und Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin statt. In der Abschlusserklärung wird eine enge Zusammenarbeit sowohl bei KI, bei der Umsetzung des GDC und bei anderen Digitalthemen vereinbart. „We recognised the impact of rapid technological change from emerging technologies such as Artificial Intelligence (AI), which presents both opportunities and threats. We agreed to work together to promote international cooperation, including under the auspices of the United Nations, for an international governance framework for AI. In line with our shared commitment to the Global Digital Compact, we agreed to support developing countries to close the digital gap, and equitably share its benefits, and mitigate risks, including those related to data protection, intellectual property, privacy, and security.“[46]
[1] https://www.intgovforum.org/en
[2] https://www.igf2025.no/
[3] https://intgovforum.org/en/filedepot_download/340/28941
[4] https://theigfwewant.net/
[5] https://intgovforum.org/en/filedepot_download/263/28629
[6] https://www.gp-digital.org/five-point-plan-for-an-inclusive-wsis20-review/
[7] https://netmundial.br/pdf/NETmundial10-MultistakeholderStatement-2024.pdf
[8] https://freedomonlinecoalition.com/foc-advisory-network-proactive-advice-wsis20/
[9] https://brics.br/pt-br/brasil-realiza-webinar-sobre-a-importancia-da-economia-de-dados-para-os-paises-do-brics
[10] https://unctad.org/topic/commission-on-science-and-technology-for-development/working-group-on-data-governance
[11] https://usun.usmission.gov/remarks-at-the-un-meeting-entitled-58th-plenary-meeting-of-the-general-assembly/
[12] https://merics.org/en/comment/chinas-global-initiative-data-security-has-message-europe
13 https://www.mfa.gov.cn/mfa_eng/xw/wjbxw/202409/t20240904_11484762.html#:~:text=The%20resolution%20calls%20on%20all,call%20from%20the%20international%20community.[13]
[14] https://docs.un.org/en/A/RES/78/311
[15] https://www.elysee.fr/en/emmanuel-macron/2025/02/11/statement-on-inclusive-and-sustainable-artificial-intelligence-for-people-and-the-planet
[16] https://www.techpolicy.press/paris-just-hosted-a-major-ai-summit-it-biggest-debate-was-a-trap/
[17] https://www.presidency.ucsb.edu/documents/remarks-the-vice-president-the-artificial-intelligence-action-summit-paris-france
[18] https://www.elysee.fr/en/emmanuel-macron/2025/02/11/the-paris-charter-on-artificial-intelligence-in-the-public-interest
[19] https://oecd.ai/en/
[20] https://hcss.nl/gcreaim/
[21] https://mcsc.io/mcsc-2025/
[22] https://www.weforum.org/stories/2025/03/ai-red-lines-uses-behaviours/?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=2848026_ForumStories-
[23] https://reports.weforum.org/docs/WEF_AI_in_Action_Beyond_Experimentation_to_Transform_Industry_2025.pdf
[24] https://initiatives.weforum.org/ai-governance-alliance/home
[25] https://www.oii.ox.ac.uk/news-events/the-ethics-of-artificial-intelligence-in-defence/
[26] https://unidir.org/publication/ai-military-domain-briefing-note-states/; https://unidir.org/publication/the-interpretation-and-application-of-international-humanitarian-law-in-relation-to-lethal-autonomous-weapon-systems/; https://unidir.org/publication/governance-of-artificial-intelligence-in-the-military-domain-a-multi-stakeholder-perspective-on-priority-areas/
[27] https://unidir.org/event/global-conference-on-ai-security-and-ethics-2025/
[28] https://docs-library.unoda.org/Open-Ended_Working_Group_on_Information_and_Communication_Technologies_-_(2021)/Letter_from_OEWG_Chair_5_March_2025.pdf
[29] https://docs-library.unoda.org/Open-Ended_Working_Group_on_Information_and_Communication_Technologies_-_(2021)/POC_comms_template_April_2025-FINAL.pdf
[30] https://docs-library.unoda.org/Open-Ended_Working_Group_on_Information_and_Communication_Technologies_-_(2021)/Letter_from_OEWG_Chair_4_April_2025.pdf
[31] https://docs-library.unoda.org/Open-Ended_Working_Group_on_Information_and_Communication_Technologies_-_(2021)/Cross_Regional_Paper_-_Practical_Modalities_to_Enable_Meaningful_Stakeholder_Participation_in_the_Future_UN_Mechanism_on_Cybersecurity_-_Feb_2025.pdf
[32] https://reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/ccw/2025/gge/documents/rolling-text-5March.pdf und https://reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/ccw/2025/gge/documents/rolling-text-6March.pdf
[33] https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/trade-and-technology-council
[34] https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/global-minimum-tax/global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two.html
[35] https://www.presidency.ucsb.edu/documents/remarks-the-vice-president-the-artificial-intelligence-action-summit-paris-france
[36] https://www.theeuropean.de/politik/im-wortlaut-die-muenchner-rede-von-jd-vance
[37] https://www.tageblatt.lu/headlines/mit-dem-gesetz-fuer-digitale-dienste-die-demokratie-schuetzen/
[38] https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&internalEPId=2017011054638&providerMeetingId=32d5603c-7c63-4e37-ac08-08dd0e0f3eb2#
[39] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_505
[40] https://digital-strategy.ec.europa.eu/de/policies/list-designated-vlops-and-vloses
[41] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_811
[42] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_816
[43] https://ccianet.org/articles/ai-act-implementation-code-of-practice-for-general-purpose-ai/
[44] https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/ai-code-practice
[45] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_25_643
[46] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_25_773