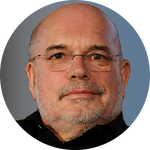Im 3. Quartal 2025 wurde die Diskussion zu Internet Governance von den folgenden fünf Themen bestimmt:
- Vorbereitung der WSIS+20 Überprüfungskonferenz
- Künstliche Intelligenz, die Rolle der UNO und die Positionierung der Großmächte
- Fortgang der UN-Verhandlungen zu Cybersicherheit
- Diskussion zu staatlicher Aufsicht über die kritischen Internet-Ressourcen
- Neue Verhandlungen zu einer globalen Digitalsteuer
I. WSIS+20 Überprüfungskonferenz
Die Vorbereitung für die WSIS+20 Überprüfungskonferenz ist im 3. Quartal 2025 in die heiße Phase getreten. Nach einer weiteren Konsultationsrunde zu dem im Juni 2025 veröffentlichten „Elements Paper“[1] haben die beiden Ko-Facilitatoren aus Albanien und Kenia am 29. August 2025 einen „Zero Draft“[2] des vorgesehenen Abschlussdokuments veröffentlicht. Der Zero Draft enthält 148 Paragrafen, die in 18 Kapitel gegliedert sind.
a. Inhaltlich hat der Zero Draft Kritiken, die in den Konsultationen zum „Elements Paper“ geäußert worden, aufgenommen. Der Zero Draft macht positive Vorschläge für eine Weiterführung des WSIS-Prozesses in der nächsten Dekade. Das Dokument orientiert sich an den WSIS-Dokumenten von Genf und Tunis (2002 – 2005), wie dem Bekenntnis zu einer „people-centered, inclusive and development-oriented Information Society“. Das Papier ruft auf zur Überwindung der digitalen Spaltung und zur Unterstützung des Multistakeholder Approach für Internet Governance. Vor dem Hintergrund der geostrategischen Spannungen bietet das Dokument für kontroverse Themen (enhanced cooperation) positive Kompromissformulierungen an. Der Zero Draft dokumentiert Fortschritte bei der Umsetzung der elf WSIS-Aktionslinien, benennt vorhandene Defizite (Infrastruktur, Finanzierung), reagiert auf neue technologische Entwicklungen (KI, Quantum), sucht eine enge Koordinierung mit der Umsetzung der nachhaltigen UN-Entwicklungsziele (SDGs) sowie dem Global Digital Compact (GDC) und entwirft eine Perspektive für die nächsten zehn Jahre (WSIS+30). Der moderate Ton des Zero Drafts ist Stärke und Schwäche zugleich. Einerseits zielt er darauf ab, destruktive Diskussionen und ein eventuelles Scheitern der WSIS+20 Verhandlungen zu vermeiden. Anderseits führt die unkonkrete Allgemeinheit vieler Empfehlungen zu einer gewissen Belanglosigkeit.
- Hinsichtlich der digitalen Spaltung stellt der Entwurf fest, dass die Zahl der Internet Nutzer von 15% im Jahr 2005 auf 67% im Jahr 2025 gestiegen ist, dass aber immer noch zwei Milliarden Menschen ohne Internet sind. Die digitale Spaltung äußere sich heute vor allem in zu hohen Kosten für den Internet-Zugang (affordability) und mangelnder Ausbildung (digital sklills gap). Fehlende finanzielle Mittel sind das Haupthindernis für die Entwicklung einer Informationsinfrastruktur im Globalen Süden. KI könne die Spaltung weiter vertiefen (AI Gap). Moderat kritisiert werden Konzentrationsprozesse in der globalen Digitalwirtschaft, die zu unfairen Wettbewerbsbedingungen und zu Diskriminierungen führen. Gefordert wird ein größeres Investment in kleinere Unternehmen, vor allen in Entwicklungsländern. Das Thema einer globalen Digitalsteuer wird nicht aufgegriffen.
- Im Kapitel zu Cybersicherheit bleibt der Zero Entwurf sehr allgemein. Sicherheit und Vertrauen im Cyberspace sei eine Voraussetzung für Innovation und nachhaltige Entwicklung. Cybersicherheit dürfe nicht gegen die Menschenrechte ausgespielt werden. Kritisiert werden „all forms of hate speech and discrimination, misinformation and disinformation, cyberbullying and child exploitgation and abuse“. Gefordert wird „capacity buidlung“ und „awareness raising“. Auch für Cybersicherheit gelte es, den Multistakeholder Approach zu stärken. Eine Bezugnahme auf die verschiedenen UN-Verhandlungen zu Cybersicherheit (OEWG, GGE LAWS, UN-Cybercrime Convention) gibt es nicht.
- Im Kapitel zu den Menschenrechten wird auf die „universality, indivisibility, interdependence and interrelation of all human right and fundamental freedoms“ verwiesen, die sowohl offline als auch online Gültigkeit haben. Gefordert wird „an open, safe, secure, stable, free, interoperable, inclusive, accessible and peaceful digital technology environment.“ Menschenrechte müssten bereits bei der Entwicklung von Technologie mitgedacht werden. Unternehmen werden an ihre Verpflichtungen nach den „UN Guiding Principles on Business and Human Rigths“ erinnert.
- Beim Thema Data Governance beschränkt sich der Zero Draft auf Verweise zum GDC und die im Mai 2025 begonnenen Arbeit der UNCSTD Working Group on Data Governance (WGDG)
- Ähnlich ist das Kapitel zu künstlicher Intelligenz konzipiert. Auch hier verzichtet der Zero Draft auf eigene Empfehlungen und verweist auf den GDC und die dort enthaltenen Vorschläge zur Gründung eines „International Scientific Panel on AI“ und den Beginn eines „Global Dialogue AI Governance“. Besonders betont wird die Notwendigkeit „to increase AI research expertise in the Global South“. Der UN-Generalsekretär wird aufgefordert ein „AI capacity building fellowship“ für Entwicklungsländer aufzusetzen.
- Das Kapitel zu Internet Governance beginnt mit der Internet Governance Definition aus der Tunis Agenda. Diese Definition gilt seit 2005 als wichtigste internationale Referenz für den Multistakeholder Approach.
- Im Unterschied zum Elements Paper betont der Zero Draft, dass multilaterale und multistakeholder Prozesse Hand in Hand gehen müssen. Er verweist darauf, das Internet Governance sowohl politische als auch technische Prozesse umfasst (encompssase both technical and public policy issue and should involve all stakeholders). Erhalten bleiben müsse „the open, free, global interoperable, reliable and secure nature auf the Internet“. Zurückgewiesen werden Modelle eines staatlich kontrollierten und fragmentierten Internet.
- Das strittige Thema „enhanced cooperation“, hinter dem sich seit 2005 Anstrengungen einiger Regierungen verbergen eine internationale staatliche Kontrolle über das Internet einzuführen, wird mit geschickten Formulierungen umgangen und ins Positive gedreht. In Paragraf 108 heisst es: „We reaffirm that Internet Governance should continue to flow the provisions set forth in the outcomes of the summits held in Geneva and Tunis, including in relation to enhanced cooperatun“.
- Das Internet Governance Forum (IGF) wird als eine „unique platform for multistakholder discussion on Internet Governance Issues“ bezeichnet, das sich von einem einmaligen Jahresevent in ein komplexes Ecosystem mit über 170 nationalen und regionalen IGFs entwickelt hätte. Im Unterschied zum Elements Paper schlägt der Zero Draft vor, das Mandat des IGF nicht nur zu verlängern, sondern dem IGF einen permanenten Status im UN-System zu geben (The IGF shall bei made a permanent forum of the UN). Gefordert wird eine Weiterentwicklung der „modalities“ des IGF, ohne dies jedoch zu konkretisieren. Beim IGF in Lillestroem war diskutiert worden, ob für die Ausarbeitung dieser Spezifikationen eine UNCSTD- oder MAG-Arbeitsgruppe gegründet werden sollte.
- Unklar bleibt der Zero Draft beim Thema IGF-Finanzierung. Para. 118 fordert eine Stärkung des IGF-Sekretariats in Genf und bittet UN Generalsekretär Guterres, Vorschläge zu erarbeiten. Wie die aussehen könnten und wie der private Sektor beteiligt werden kann sagt der Zero Draft nicht.
- Im Kapitel über die Zukunft des WSIS-Frameworks wird darauf orientiert, die elf WSIS-Aktionslinien enger mit den 16 SDGs und der Umsetzung der GDC-Empfehlungen zu verzahnen. Synergie seien zu nutzen und eine Vergeudung von Ressourcen durch Duplikationen zu verhindern. Für die im Jahr 2030 anstehende SDG-Überprüfungskonferenz wird eine angemessene Berücksichtigung der Ergebnisse von WSIS+20 eingefordert.
- Eine besondere Rolle für die Umsetzung der WSIS-Aktionslinien komme zukünftig der UN-Group for the Information Society (UNGIS) zu. UNGIS gehören rund 40 UN-Organisationen an. UNGIS sollte sich in eine „platform for multistakeholder dialogue“ entwickelt und offen sein für „multistakeholder advice“. Der bei den Konsultationen zum Elements Paper eingebrachte Vorschlag, UNGIS durch die Bildung einer „Stakeholder Advisory Group“ (SAG) institutionell zu ergänzen und sich dabei auf die „Sao Paulo Multistakeholder Guidelines“ (SPMGs) zu berufen, fand keinen Eingang im Zero Draft. Gestärkt werden soll auch die UNCSTD als ein WSIS-Koordinierungsgremien sowie als Schaltstelle zum ECOSOC und zur UN-Vollversammlung (UNGA).
- Im Jahr 2035 soll es eine weitere Überprüfungskonferenz (WSIS+30) geben. Für das dann geplante „high-level meeting“ wird bereits jetzt die weitere Ausgestaltung des Multistakeholder Ansatzes gefordert: „Involving the input and participation of all stakeholders, including in the preparatiy process.“
b. Gemäß der WSIS+20 Preparatory Process Roadmap[3] waren Kommentare zum Zero Draft bis zum 3. Oktober 2025 bei UNDESA einzureichen. Die Roadmap terminiert auch die weiteren Schritte auf dem Weg zum High-Level Meeting, das für den 16. und 17. Dezember 2025 im Rahmen der 80. UN-Vollversammlung New York geplant ist.
- Eine virtuelle Konsultationsrunde mit Stakeholdern zum Zero Draft ist für den 13. und 14. Oktober 2025 angesetzt. Danach beginnen ab 15. Oktober 2025 in New York die formellen Regierungsverhandlungen. Wie offen diese für Stakeholder sind und welche Rolle der neu geschaffene „Informal Multistakeholder Sounding Board“ (IMSB) dabei spielt, ist noch unklar. Am Rande des ICANN Treffens in Dublin wird es am 27. und 28. Oktober 2025 Konsultationen mit den Ko-Facilitatoren aus Kenia and Albanien geben.
- Im Lichte dieser Konsultationen und der ersten Verhandlungsrunde wird ein überarbeiteter Entwurf des Abschlussdokument für Anfang November 2025 erwartet. Dieser Entwurf wird Gegenstand weiterer Stakeholder Konsultationen sein und die Grundlage für die finalen Regierungsverhandlungen sein (Dezember 2025). Nach den von der UNGA verabschiedeten Prozeduren für WSIS+20 obliegt es der Präsidentin der UNGA, der ehemaligen deutschen Außenministerin Annalena Baerbock, den „Input“ der Stakeholder Konsultationen „einzusammeln“ und dafür zu sorgen, dass dieser „Input“ in die Regierungsverhandlungen eingebracht wird. Wie dies konkret geschehen soll, ist noch unklar.
- Das Abschlussdokument soll am 17. Dezember 2025 in New York in Form einer UN-Resolution verabschiedet werden. Die vorgeschaltete zweitätige hochrangige Konferenz soll auf Ministerebene stattfinden. WSIS-Dokumente sind bislang im Konsens angenommen worden. Bei der UNCSTD-Tagung im April 2025 in Genf wurde jedoch erstmalig über eine WSIS-Resolution abgestimmt. Die USA stimmten als einziges Land mit „Nein“. Sie lehnten Bezüge in der WSIS-Resolution zu den SDGs, zu Gender und Klimawandel ab. Abstimmungen über UN-Resolutionen mit Nein-Stimmen und Stimmenthaltungen sind in der UNGA-Praxis keine Seltenheit. In der UNGA gibt es im Unterschied zum UN-Sicherheitsrat kein Veto-Recht eines Landes.
c. Regierungen haben sich bislang mit Kommentaren zum Zero Draft zurückgehalten. Im Abschlussdokument des Gipfeltreffens der Shanghai Cooperation Organisation (SCO) wird WSIS+20 nicht erwähnt. Das Dokument enthält jedoch einen Artikel der eine staatliche Regulierung der „national Internet segments“[4] fordert. Einige Regierungen wie Schweiz, Australien und Großbritannien haben grundsätzlich positiv auf den Zero Draft reagiert. Am deutlichsten hat sich die EU geäußert. Das Europäische Parlament hat sich am 10. September 2025 in einer Resolution für einen permanenten Status das IGF innerhalb der UNO ausgesprochen und hinter das Multistakeholder Modell für Internet Governance gestellt (to permanently renew the mandate of the IGF, and to strengthen its resources and the multistakeholder model of internet governance)[5]. Auch EU-Kommissarin Hella Virkkunen hat sich für ein permanentes IGF eingesetzt.[6] Die am 15. Oktober 2025 in New York beginnenden Verhandlungen werden ein erster Test sein, ob WSIS+20 weitgehend unproblematisch über die Bühne geht oder zu einer Plattform von geo-politischen Kontroversen wird.
II. Künstliche Intelligenz
Die internationale Diskussion zu künstlicher Intelligenz wurde im 3. Quartal 2025 vor allem durch zwei Ereignissen geprägt. Einerseits hat sich UNO Ende August 2025 abschließend auf die Modalitäten zur Schaffung zwei neuen KI-Gremien innerhalb der UNO – dem KI-Panel und dem KI Governance Dialog – geeinigt. Andererseits haben die USA und China Ende Juli 2025 ihre globalen KI-Strategien vorgestellt. Beide Strategien unterscheiden sich nicht unwesentlich und nehmen unterschiedlich Bezug auf die Entwicklungen innerhalb der UNO. Darüber hinaus verkünden immer mehr Staaten und Staatengruppierungen (BRICS & G7) ihre KI-Strategie.
a. Am 29. August 2025 hat die 79. UN-Vollversammlung mit der Resolution 79/302[7] endgültig grünes Licht gegeben für die Schaffung der beiden neuen UN-Gremien zu KI: Das Independent Scientific Panel on Artificial Intelligence/ISPAI (KI-Panel)) und den Global Dialogue on Artificial Intelligence Governance/GDAIG (KI-Dialog).
- Das KI-Panel soll aus 40 Mitgliedern bestehen, die von der UN-Vollversammlung auf Vorschlag des UN-Generalsekretärs für einen Zeitraum für drei Jahre gewählt werden.
- Mitglieder des Panels werden „in their personal capacity“ gewählt und nicht als Repräsentant eines Landes oder einer Institution. Jedoch gibt es eine Grenze von nicht mehr als zwei Vertretern pro Land und Unternehmen. Mitglieder des KI-Panels müssen eine „Conflict of Interest“ (COI) Erklärung abgeben, um die Unabhängigkeit des Gremiums zu sichern und ein „Capture“ das KI-Panels durch kommerzielle oder politische Gruppen zu verhindern. UN-Beamte sind von einer Mitgliedschaft ausgeschlossen. Geleitet wird das Panel von zwei Co-Chairs, je einer aus dem Norden und dem Süden. Die Bildung von Arbeitsgruppen und Beratergremien ist möglich.
- Konzipiert ist das KI-Panel nach dem UN-Klimarat. Es soll jährlich einen umfassenden Bericht über den Stand der KI-Entwicklung in der Welt sowie thematische Papers veröffentlichen. Der Bericht soll auf der Basis von „independence, scietific credibility amd rigour multidisciplinary and inclusive participation“ entstehen und umfassend aufklären über neu sich entwickelnde Möglichkeiten und Risiken. Der Bericht dient als Grundlage für den KI-Dialog.
- Der KI-Dialog soll einmal jährlich für jeweils zwei Tage im Zusammenhang mit einer bereits existierenden UN-Konferenz stattfinden.
- Der KI-Dialog soll in einem Multistakeholder Format mit einem starken „intergovernmental segment“ organisiert werden „as a platform to discuss international cooperation, share best practices and lessons learned, and to facilitate open, transparent and inclusive discussions on AI governance with a view to enabling AI to contribute to the implementation of the SDGs and to closing the digital divides between and within countries.“ Diskutiert werden sollen die „sozialen, wirtschaftlichen, ethischen, kulturellen, linguistischen und technischen Implikationen“ von KI. Der Dialog soll dazu beitragen Kapazitätslücken, insbesondere zwischen Nord und Süd, zu schließen und auf eine Interoperabilität verschiedener KI-Governance Ansätze hinwirken. Diskutiert werden sollen robuste Aufsichtsgremien für KI-Systeme, deren Transparenz und Verantwortlichkeiten, die Nutzung von Open Source, Open Data und Open KI Modellen sowie die Beachtung von Menschenrechten.
- Am 25. September 2025 fand in New York ein informeller Kick-Off des KI-Dialogs in Anwesenheit von UN-Generalsekretär Guterres und der Präsidentin der UNGA, Baerbock, statt.[8] Der 1. KI-Dialog ist für Juli 2026 in Genf am Rande des „AI for Good Summit“ der ITU geplant. Die Präsidentin der UNGA muss noch zwei Co-Chairs benennen die im Rahmen von „intergovernmental consultations“ die Prioritäten ermitteln sollen. Staaten sind aufgefordert durch freiwillige Beiträge die Teilnahme von Experten aus dem globalen Süden zu ermöglichen. Der 2. KI-Dialog soll am Rande des UN-Forums für Wissenschaft, Technologie und Innovation (STI-Forum) in New York im Juni 2027 stattfinden. Über die Weiterführung des KI-Dialogs soll dann im Rahmen der GDC-Überprüfungskonferenz im Jahr 2027 befunden werden.
- Der Vorschlag, den KI-Dialog auch mit dem IGF zu verbinden, setzte sich nicht durch. Auch bei der Kick-Off Veranstaltung des KI-Dialogs am 25. September 2025 gab es weder von Guterres noch von Baerbock Referenzen zum IGF. Das wurde wiederum bei zahlreichen Kommentaren zum WSIS+20 Zero Draft kritisiert. Gefordert wurde eine engere Abstimmung zwischen dem IGF und seinem „IGF Policy Network on Artificial Intelligence“[9] mit dem neuen KI-Dialog der UNO.
b. Am 23. Juli 2025 stellte US-Präsident Donald Trump seine neue globale KI-Strategie unter dem Titel „Winning the Race: America´s AI Action Plan“[10] im Weißen Haus vor. Drei Tage später, am 26. Juli 2025 präsentierte Chinas Ministerpräsident Li Qiang im Rahmen der „World AI Conference“ (WAIC) in Shanghai das chinesische Konzept für eine globale Strategie unter dem Tiel „Action Plan on Global AI Governance“[11].
- Bereits der Titel des US-Dokuments „Winning the Race“ macht den Charakter der US-Strategie klar. Die USA wollen die KI-Welt von morgen dominieren. Im Vorwort schreibt Präsident Trump: „Beakthroughs in AI have the potential to reshape the global balance of power, spark entirely new industries, and revolutionize the way we live and work. As our global competitors race to exploit these technologies, it is a national security imperative for the US to achieve and maintain unquestioned and unchallenged global technological dominance.“ Das Paper enthält drei Kapitel: 1. KI-Innovation, 2. KI-Infrastruktur, 3. KI-Diplomatie:
- Im Abschnitt KI-Innovation geht es um digitale Skills und Beseitigung von regulatorischen und bürokratischen Hemmnissen für KI-Entwicklungen. Das Bildungssystem der USA müsse grundsätzlich auf KI-Anforderungen umgestellt werden, um genügend KI-Arbeiter zu haben, die die führende Rolle der USA sichern können. Regulierungen dürfe nicht Innovationen begrenzen. Zuerst müssten KI-Möglichkeiten genutzt, erst dann auch die KI-Risiken diskutiert werden.
- Im Abschnitt KI-Infrastruktur geht es um den Aufbau von KI-Fabriken und Daten-Zentren, sowie die Entwicklung und die Produktion von Chips der jeweils neuesten Generation. Notwendig sei der Aufbau einer sicheren Cyberinfrastruktur. Entwickelt werden müssten „Secure by Design AI Technologies and Appliations“.
- Der Abschnitt KI-Diplomatie zielt darauf, amerikanische KI-Systeme zum Weltstandard zu machen. „The US must also drive adoption of American AI systems, computing hardware, and standards throughout the world.“ Die Strategie bietet gleichgesinnten Staaten eine enge Kooperation unter Führung der USA an. Das Dokument verweist auf Initiativen der UN, OECD, G7, G20, ITU und ICANN, sieht diese aber mit Skepsis. „Too many of these efforts have advocated for burdensome regulations, vague “codes of conduct” that promote cultural agendas that do not align with US values, or have been influenced by Chinese companies attempting to shape standards for facial recognition and surveillance“.
- China“s „Global AI Governance Action Plan“ vom 26. Juli 2025 wählt einen anderen Ansatz. In seinen 13 Kapiteln vermeidet er einen „China First“ Ansatz und fordert eine Ausweitung gleichberechtigter internationaler KI-Zusammenarbeit auf der Basis „globaler Solidarität“. Möglichkeiten und Risiken der technologischen Revolution müssten gleichermaßen ins Kalkül gezogen werden. Gefordert wird eine „inclusive, open, sustainable, fair, safe, and secure digital and intelligent future for all“. KI müsse entwickelt werden „in service of humanity, respecting national sovereignty, aligning with development goals, ensuring safety and controllability, upholding fairness and inclusiveness, and fostering open cooperation“.
- Ähnlich dem US-Paper setzt China auf Innovation, Infrastruktur und Kapazitätsentwicklung. Gefordert wird eine „innovation friendly policy environment“, eine Stärkung von „policy and regulatory coordination“ and „the removal of technology barriers.“ Im Unterschied zum US-Paper aber nimmt der chinesische Plan die Interessen der Entwicklungsländer mit ins Blickfeld, betont die Notwendigkeit gleichberechtigter Kooperation und Hilfestellung beim Aufbau von diversen, offenen und innovativen KI-Ecosystemen, die auch auf Open Source basieren sollen. Charles Mok bezeichnete das in „Tech Policy Press“[12] als „chinesische KI-Charmeoffensive“. Sie bedeute nicht, dass China keine technologische Überlegenheit anstrebt und seine nationale Sicherheit nicht schützt. Dies sei aber nicht das primäre Anliegen des Aktionsplanes. Der ziele darauf das chinesische Modell als Alternative zu „Winning the Race“ zu präsentieren.
- Besonderes Augenmerk legt China auf den „Public Sector“. Der Schutz von persönlichen Daten wird betont. Meinungsäußerungsfreiheit und Massenüberwachung finden jedoch keine Erwähnung. Berücksichtigt werden die KI-Konsequenzen für die Umwelt. Entwickelt werden sollen “low power chips and efficient algorithms“. Es gelte die „social ethics“ zu stärken. Standards müssten helfen, auf Algorithmen basierende Vorurteile und Diskriminierungen zu beseitigen. Das sei Aufgabe von Standardisierungsorganisationen wie ITU, ISO und IEC.
- Was die Rolle der UNO betrifft, so stellt sich der Aktionsplan hinter die neue UN-Initiativen für ein KI-Panel und einen KI-Dialog. Die im GDC anvisierten Ziele müssten umgesetzt werden, auch durch eine Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen allen Stakeholdern. In Kapitel 13 wird der Aufbau eines inklusiven Multistakeholder KI-Governance Modell vorgeschlagen: „We support the establishment of inclusive governance platforms based on public interests and the joint participation of relevant entities. We encourage AI enterprises from different countries to engage in dialogue and exchanges, learn from each other’s application practices in various fields of AI, and promote innovation, application, as well as ethical and safety cooperation in specific domains and scenarios“.
- Der Vorschlag für eine neue internationale Multistakeholder KI-Organisation mit Sitz in Shanghai sorgte für Aufsehen. Wofür sollte eine solche Organisation verantwortlich sein und wie würde sie sich zu den zwei neuen UN-Institutionen verhalten? Beobachter verglichen den Plan mit der Auseinandersetzung um das DNS in den 1990er Jahren zwischen der ITU und den USA, die in der Gründung von ICANN, einer privaten Gesellschaft mit Sitz in Los Angeles, mündete. Führende private chinesische KI-Unternehmen haben bereits ein Interesse bekundet, sich an einer solche neue Organisation zu beteiligen.
c. Am 6. Juli 2025 verabschiedeten die BRICS-Staaten bei ihrem Gipfel in Rio de Janeiro ein „BRICS Leaders' Statement on the Global Governance of AI“.[13] Neben den fünf Gründungsmitgliedern Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika gehören jetzt sechs weitere Staaten (Saudi Arabien, Ägypten, Vereinigte Arabische Emirate/UAE, Äthiopien, Indonesien und Iran) sowie zehn Beobachter (Belarus, Bolivien, Kazachstan, Kuba, Malaysia, Thailand, Uganda, Uzbekistan, Nigeria und Vietnam) zu BRICS.
- Die Erklärung enthält in fünf Kapiteln insgesamt 21 Empfehlungen. Im Zentrum stehen Empfehlungen zur Stärkung nationaler KI-Kapazitäten, zum Ausbau der Infrastruktur, zur Förderung von Innovation und Weiterbildung. Der jungen Generation müssten nachhaltige und würdige Arbeitsmöglichkeiten geboten werden. Entwicklungsländer dürften nicht in die Rolle von „Datenlieferanten“ gedrängt werden, sondern gleichberechtigt und auf Augenhöhe mit anderen Staaten zum gegenseitigen Vorteil kooperieren. „Digital Sovereignty and the Right to Development are central to Global AI Governance“ heisst es in dem Statement. Und „Collaborative Governance of AI is Complex, but possible“.
- Die BRICS Erklärung unterstürzt einen regelbasierten Ansatz für KI. „Fair Competition and Market Regulation“ seien zentrale Elemente einer KI-Zukunft. Zugangsbarrieren zu KI-Technoligen oder Finanzierungen müssten abgebaut, der Schutz geistigen Eigentums und öffentlicher Interessen der Entwicklungsländer gestärkt werden. Das müssten international vereinbarte technischen Standards reflektieren. „We must avoid standard setting processes being used as barriers to market entry for smaller companies and developing countries“.
- Die BRICS Erklärung stellt sich hinter den GDC und die beiden neuen KI-Gremien der UNO: „The UN is Central to Global AI Governance“. Allein die UN böte Entwicklungsländern die Möglichkeit, gleichberechtigt an internationalen KI-Diskussionen teilzunehmen. Gewarnt wird vor einer Fragmentierung der KI Governance Diskussion in regionalen oder privaten Gremien (OECD, G7, Bletchley Prozess). Die UN sei das einzige „fully inclusive and representative international framework.“
d. Die G7 Staaten (USA, Canada, Japan, Italien, Frankreich, Großbritannien und Deutschland) haben bereits im Juli 2023 auf dem G7 Gipfel in Hiroshima eine KI-Strategie verabschiedet (Hiroshima AI Process/HAIP)[14].
- Beim G7 Gipfel im Juni 2025 in Kananaskis/Kanada wurde diese Strategie weiter entwickelt. Das am 17. Juni 2025 verabschiedeten „G7 Leaderrs Statement on AI for Prosperity“[15] ergänzt den „G7 Action Plan for a human centered adotion of safe, secure and trustworthy AI“[16] von 2024. Damit haben die G7 Staaten ein umfassendes Rahmenwerk zur KI-Entwicklung. Sie setzen nach wie vor hauptsächlich auf die OECD als Plattform und auf die Stärkung der Rolle des privaten Sektors, beteiligen sich aber auch an den beiden neuen UN-Gremien zu KI.
- Der KI-Strategie der G7 liegt ein „human centered approach“ zu Grunde. KI Innovationen müssen den Menschen nutzen, Risken minimieren und die nationale Sicherheit stärken. Ausführlich widmet sich das neue Statement Themen wie der explodierende Energiebedarf für KI-Fabriken und Datenzentren sowie die Stärkung des öffentlichen Sektors bei der Anwendung von KI für Bereiche wie Bildung, Gesundheit, Transport und Umwelt. Neu diskutiert wurde auch die Konsequenzen für Kultur und die Kreativwirtschaft.
- Gestärkt werden soll die Partnerschaft mit „emerging markets and developing country partners“. Gefördert werden sollen Investitionen in klein- und mittelständische Unternehmen sowie „locally led AI enabled innovation“. Gestärkt werden soll die Zusammenarbeit mit Universitäten in Entwicklungsländern. Das Dokument bezieht sich in seiner Präambel kurz auf den GDC, vermeidet aber in seinen operativen Teilen jeden Bezug zu den KI-Initiativen der UNO. Neue finanzielle Mittel wurden von den G7 Staaten nicht bereitgestellt.
- Als Annex zu dem Statement wurde eine „G7 AI Adoption Roadmap“ vereinbart, die u.a. eine Stärkung von klein- und mittelständischen Unternehmen, Maßnahmen zur Stärkung von Vertrauen in KI-Anwendungen und einen Austausch von Talenten vorsieht. Die USA schlossen sich der Erklärung an, machten aber deutlich, dass ihre nationale Strategie, die vier Wochen später vom Weißen Haus verabschiedet wurde, Vorrang gegen über dem HAIP hat.
III. Cybersicherheit
Das Thema Cybersicherheit stand im 3. Quartal 2025 bei mehreren Konferenzen auf der Tagesordnung. Die finale Sitzung der Open Ended Working Group (OEWG) fand im Juli 2025 in New York statt[17], die Herbsttagung der GGE LAWS zu autonomen Waffensystemen im September 2025 in Genf[18]. Parallel wurden Vorbereitungen für die Unterzeichnung der neuen UN-Konvention gegen Cyberkriminalität getroffen. Die Signatur-Zeremonie ist für den 24. Oktober 2025 in Hanoi angesetzt. Bei der 60. Sitzung des UN-Menschenrechtsrat im September 2025 in Genf wurde ein Bericht „Human rights implications of new and emerging technologies in the military domain“ diskutiert[19].
a. Nach fünf Jahren beendete die OEWG ihre Tätigkeit mit der Annahme eines Schlussberichts am 27. Juli 2025 in New York.[20] Ungeachtet der geostrategischen Spannungen wurde der Bericht im Konsensus verabschiedet, auch wenn einige Regierungen, darunter Russland, einseitige Erklärungen mit abweichenden Meinungen abgaben. Der Schlussbericht empfiehlt, die OEWG in einen sogenannten permanenten „Globalen Mechanismus“ zu überführen, der die fünf substantiellen Themen, die die OEWG seit 2020 beschäftigt hatten, weiter diskutieren soll. Sollte der 1. UNGA-Ausschuss zustimmen, hätte das Thema Cybersicherheit jetzt ein institutionelles „zu Hause“ im UN-System.
- Insgesamt ist die Bilanz der OEWG durchwachsen. Das von den westlichen Staaten seit 2021 eingeforderte „Program of Action“ (PoA), mit dem die Umsetzung der bereits 2015 verabschiedeten elf politischen Grundätze für ein verantwortungsvolles Verhalten von Staaten im Cyberspace evaluiert werden sollte, ist nicht zustande gekommen. Aber auch Russlands Vorschlag, die elf Normen um weitere Normen zu ergänzen und in eine völkerrechtlich bindende UN-Konvention zu überführen, wurde nicht akzeptiert. Die westlichen Saaten weigern sich nicht, eine Diskussion über weitere Normen zu führen, argumentieren aber, dass man zunächst Klarheit schaffen sollte, wie die existierenden Normen, die mittlerweile als „UN Cybersecurity Framework“ weithin anerkannt sind[21], praktiziert werden, bevor man über neue Normen und deren völkerrechtliche Verbindlichmachung redet. Die Diskussion wird sich wohl auch im neuen „Global Mechanismus“ zunächst weiter im Kreis drehen. Ein Mandat für die Ausarbeitung einer verbindlichen UN-Konvention zu Cybersicherheit enthält der OEWG-Abschlussbericht nicht.
- Unbefriedigend bleibt auch die Diskussion zur Anwendung des Völkerrechts im Cybespace. 2013 hatte eine Group of Governmental Experts (GGE) Einigung darüber erzielt, dass das Völkerrecht, und hier insbesondere die sieben jus cogens Prinzipien der UN-Charta, auch für den Cyberspace gelten, d.h. sowohl offline als auch online relevant sind.[22] Auch hier sollte ein PoA herausfinden, wie die UN-Mitgliedstaaten diese Vereinbarung umsetzen. Einige Regierungen haben in den letzten Jahren nationale Positionspapiere vorgelegt, wie sie die Anwendung des Völkerrechts im Cyberspace praktizieren. Einen kompletten Überblick gibt es aber nicht. Der neue „Gobal Mechanism“ muss auch hier Nacharbeit leisten.
- Ein konkretes Resultat brachte die Diskussion zu vertrauensbildenden Maßnahmen im Cyberspace (CBMCs). Nach langen Diskussionen einigten sich die 193 UN-Staaten auf die Schaffung eines internationalen „Point of Contact Directory“ (PoC)[23]. Das PoC soll wie das „rote Telefon“ zwischen den Nuklearmächten funktionieren. Jedes UN-Mitglied benennt einen Kontakt, der im Falle eines die Cybersicherheit betreffenden Vorfalls angesprochen werden kann. Damit sollen Missverständnisse vermieden, unbeabsichtigte Fälle von Verletzungen der Cybersicherheit geklärt und Spannungsfälle de-eskaliert werden. Ein solches PoC-Directory existiert bereits im Rahmen der OSZE für 53 Staaten und hat sich dort bewährt. Die Ausweitung dieses Mechanismus auf 193 Staaten wurde weithin begrüßt. Es bleibt abzuwarten, wie es praktisch funktioniert. Bereits in den ersten Wochen des neuen PoC war zu beobachten, dass einige Staaten mit einer regelrechten Welle von teils unbegründeten Nachfragen die Belastbarkeit des Systems zu testen scheinen. Eine erste Evaluierung des PoC Mechanismus ist für 2026 vorgesehen.
- Kleine Fortschritte gab es bei den kapazitätsbildenden Maßnahmen. Alle 193 OEWG-Mitglieder waren sich einig, dass hier insbesondere für Entwicklungsländer ein Handlungsbedarf besteht und Maßnahmen benötigt werden, um Regierungen in die Lage zu versetzen, ihre Cybersicherheit selbst zu schützen. Die Debatte entzündete sich daran, wer solche Maßnahmen durchführt, wie die Lehrprogramme zu gestalten sind und wer sie finanziert. 2023 fand erstmal ein Round Table statt, an dem neben Regierungen auch nicht-staatliche Stakeholder gleichberechtigt vertreten waren. Das Round Table soll nach den Empfehlungen des OEWG-Abschlussberichts als ein parmanentes Gremium installiert und untersetzt werden durch ein Global ICT Security Cooperation and Capacity Building Portal (CCBP).
- Ein ständiger Streitpunkt der OEWG war die Beteiligung von nicht-staatlichen Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und der technischen Communuty. Der OEWG-Vorsitzende Burhan Gafoor aus Singapur hatte sich seit 2021 dafür eingesetzt, den Stimmen der nichtstaatlichen Srakeholder Gehör zu verschaffen. Einge Regierungen lehnten eine solche Beteiligung ab. Der Kompromiss war, das NGOs, die eine Akkreditierung vom ECOSOC hatten, an den OEWG-Beratungen teilnehmen können. Jene nicht-staatlichen Stakeholder, die nicht über eine ECOSOC Akkreditierung verfügten, konnten eine Teilnahme beantragen, bedurften aber der Zustimmung aller 193 OEWG Mitglider. Damit hatte jeder Regierung ein Veto Recht gegen unliebsame NGOs. Vor allem Russland verbannte rund 30 NGOs, darunter das Weltwirtschaftsforum Davos (WEF) und die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP). Im Umkehrschluss legte die Ukraine u.a. gegen das Moskauer Institut für internationale Beziehungen (MGIMOI) ein Veto ein. Die neuen Empfehlungen (Additional Elements on Modalities on the Participation of Other Interested Parties and Stakeholders, including Businesses, Non-Governmental Organizations and Academia) sehen eine geringfügige Flexibilisierung vor. Regierungen besitzen nach wie vor ein Veto-Recht. Wenn sie davon Gebrauch machen, müssen sie das aber öffentlich begründen und unter in Konsultationen eintreten.
- Der OEWG-Schlussbericht wird vom 1. UNGA Ausschuss im Oktober 2025 diskutiert. Sollte er angenommen werden, würde die 80. UNGA in einer UN-Resolution im Dezember 2025 den Global Mechanism formell etablieren. Der Global Mechanism besteht aus einer Plenarversammlung mit allen 193 UN-Staaten sowie zwei thematischen Arbeitsgruppen. Er soll jährlich zweimal tagen und der UN-Vollversammlung berichten. Die erste Sitzung könnte im März 2026 in New York stattfinden.
b. Die Herbstsitzung der GGE LAWS fand Anfang September 2025 in Genf statt. Der Druck auf die GGE Laws, die seit zehn Jahre verschleppten Verhandlungen zu einem konkreten Ergebnis zu führen, waren im Vorfeld erheblich gewachsen. UN Generalskretär Guterres und der Präsident der Internationalen Roten Kreuzes fordern vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung dieser Waffensysteme und ihrer Anwendung in der Ukraine, im Nahen Osten und in Afrika den Abschluss eines Abkommens bis Ende 2026.
- Die Genfer Sitzung konnte sich am 6. September 2025 auf wesentliche Elemente eines „Rolling Texts“ verständigen. Grundidee eines möglichen Abkommens ist ein sogenannter „Two Tier-Approach“. Einerseits sollen autonome Waffensysteme, die sich einer menschlichen Kontrolle entziehen und selbständig Ziele – Objekte oder Personen – identifizieren, um sie zu zerstören bzw. zu töten, verboten werden. Andererseits soll der Einsatz anderer autonomer Waffensysteme, die KI nutzen, an die Regeln des humanitären Völkerrechts, wie sie in den Genfer Konventionen von 1949 zum Schutz der Zivilbevölkerung in bewaffnen Konflikten enthalten sind, gebunden werden.
- Seit 2023 wird das Thema, dank einer Initiative aus Österreich, auch in der UN-Vollversammlung diskutiert. 2024 hat UN-Generalsekretär Guterres einen Bericht mit Stellungnahmen von mehr als 100 Regierungen und NGOs veröffentlicht.[24] Der Bericht war im Mai 2025 bei zweitätigen informellen Konsultationen in New York diskutiert worden.[25] Im Oktober 2025 wird sich der 1. UNGA-Ausschuss mit dem Ergebnis befassen und über die nächsten Schritte entscheiden.
- Nach Abschluss der GGE LAWS Verhandlungen in Genf hat Brasilien im Namen von 41 Staaten ein Statement publiziert, in dem die sofortige Aufnahme von formellen Verhandlungen zu einem völkerrechtlichen LAWS-Vertrag gefordert wird. „The rolling text, contains a set of elements that we consider as sufficient basis for negotiations of an instrument on lethal autonomous weapon systems“.[26]
c. Die von der 79. UN-Vollversammlung im Dezember 2024 verabschiedete UN-Konvention gegen Cyberkriminalität[27] wird am 24. Oktober 2025 in Hanoi offiziell zur Unterschrift aufgelegt.[28] Die Konvention tritt 90 Tage nach Hinterlegung der 40. Ratifikationsurkunde in Kraft.
- Kritiker der Konvention bemängeln vage Definition der Straftatbestände, unzureichende menschenrechtliche Sicherungen bei grenzüberschreitender Strafverfolgung sowie die Absicht, ein Protokoll auszuarbeiten, das sich mit der Verbreitung von strafbaren Inhalten im Cyberspace befasst. Die westlichen Staaten hättern es lieber gesehen, wenn alle 193 UN-Staaten der Budapest Konvention des Europarates aus dem Jahr 2001 beigetreten wären. Diese Konvention hat klare Definition und Schutzmechanismen. Viele Entwicklungsländer fühlten sich aber durch die Budapest Konvention, an deren Ausarbeitung sie nicht beteiligt waren, nicht repräsentiert. Bislang haben 71 Staaten die Budapest Konvention ratifiziert.
- Die neue UN-Konvention gegen Cyberkriminalität steht nicht in Widerspruch zur Budapest Konvention. Staaten können beiden Konvention beitreten. Die zukünftige Praxis wird zeigen, welches Instrument effektiver ist. Die EU-Staaten haben bereits die Absicht bekundet, die neue „Hanoi-Konvention“ zu unterzeichnen. Die USA hatten im Dezember 2024 unter Vorbehalt der Annahme der Konvention zugestimmt. Es bleibt abzuwarten, ob die neu US-Administration zu diesem Wort steht. Nachhaltige Unterstützung für die Konvention kommt von den Staaten der Shanghai Cooperation Organisation (SCO) und BRICS.
d. Bei der 60. Sitzung des UN-Menschenrechtsrat im September 2025 in Genf stand ein Bericht „Human rights implications of new and emerging technologies in the military domain“[29] auf der Tagesordnung. Der Bericht untersucht auf 20 Seiten mögliche Konsequenzen für Menschenrechte durch KI-Anwendungen im militärischen Bereich. Der Bericht diskutiert Szenarien im Zusammenhang mit „lethal autonomous weapons systems, cognitive warfare and energy weapons“. Untersucht wird, welche Folgen KI hat für die Kontrolle von atomaren, biologischen und chemischen sowie konventionellen Waffen. Betont wird, dass Regierungen nach dem Völkerrecht und den Genfer Konvention menschenrechtliche Verpflichtungen haben, die bei der Entwicklung und Anwendung von Waffensystemen zu berücksichtigen sind. In sieben Empfehlungen werden die Regierung an ihre Verantwortung erinnert, vier Empfehlungen richten sich an nicht-staatliche Stakeholder.
IV. Staatliche Kontrolle über Internet Ressourcen
Im 3. Quartal 2025 ist die Diskussion über Möglichkeiten für eine internationale staatliche Kontrolle über die kritischen Internet Ressourcen wieder aufgeflammt. Russland hat das Thema auf die Tagesordnung der ITU Council Working Group on International Internet Related Public Policy Issues (CWG-Internet) im September 2025 in Genf gesetzt. Indirekt stand das Thema auch zur Debatte bei den Gipfeltreffen der SCO und verschiedener BRICS Meetings sowie bei den WSIS+20 Konsultationen.
a. Seit Jahren versucht Russland die ITU, und hier insbesondere die CWG-Internet, zu benutzen, um das Thema einer staatlichen Kontrolle über das Management kritischer Internet Ressourcen aufzuwerfen. Russische Vertreter verweisen auf angebliche Verantwortungslücken in existierenden Mechanismen wie ICANN, RIRs und der IETF. Der stellvertretende russische Außenminister Verschinin hatte im April 2025 in einem Gespräch mit dem UN-Tech Envoy Amandeep Gil Singh von einer „Internet Management Gap“ gesprochen[30]. Beim russischen „Global Digital Dialog“ im Juni 2025 in Nishni Nowgorod wurde erneut die Idee diskutiert, ein neues zwischenstaatliches Gremium für die Aufsicht über das Management von Domainnamen, IP Adressen und Internet Protokollen zu schaffen.
b. Bei der 22. Tagung der CWG Internet im September 2025 schlug Russland vor, einen Fragebogen an alle ITU-Staaten zu verschicken, um herauszufinden, welche Akzeptanz das etablierte Systeme des Internet Ressourcen Management hat. Hinterfragt werden sollte, ob das Internet als ein „global public good“ zu definieren sei, ob existierende nationale und internationale Rechtsvorschriften auf das Management kritischer Ressourcen Anwendungen finden und inwieweit private Organisationen in der Lage sind, im öffentlichen Interesse zu agieren. Gefragt wird auch ob eine internationale Koordinierung überhaupt nötig ist: „Is it possible for States to manage the Internet at the national level without international coordination?“[31] Der Vorschlag fand keine Mehrheit. Selbst potentielle Unterstützer Russlands verwiesen auf die „Komplexität“ und das begrenzte Mandat der CWG-Internet. Man könne das Thema eventuell auf der nächsten ITU-Generalversammlung (ITU-PP 26) im Herbst 2026 in Quatar diskutieren.[32]
c. Der Vorschlag Russland, einen staatliche Aufsichtsmechanismus für das Management kritischer Internet Ressourcen trifft jedoch selbst bei den russischen Partnern in BRICS und der SCO auf wenig Unterstützung. Weder das SCO-Gipfeltreffen im September 2025 in Tijain noch das BRICS Gipfeltreffen im Juni 2025 in Rio de Janeiro haben den Vorschlag unterstützt. Die SCO-Deklaration betont jedoch das Prinzip der digitalen Souveränität. „It considers it is important to ensure equal rights for all countries to regulate the Internet and the sovereign right of states to manage it in their national segments“
d. Bei der abschließenden Sitzung der OEWG im Ende Juli 2025 stimmte der russische Vertreter zwar dem Abschlussbericht zu, gab aber eine einseitige Erklärung ab, in der er die russische Forderung nach der Ausarbeitung von rechtsverbindlichen Normen für den Cyberspace wiederholte. Der neue globale Mechanismus müsse sich konzentrieren „on developing new legally binding norms in the field of digital security.“ Gleichzeitig kritisierte er die Teilnahme nicht-staatlichen Stakeholder, die ihre Rolle für anti-russische Propaganda missbrauchen würden. „We insist that it is unacceptable to undermine the intergovernmental nature of negotiations on security in the field of ICT use within the framework of the Global Mechanism“.[33]
e. Im Rahmen der Konsultationen zu WSIS+20 haben sich russische Regierungsvertreter mit Forderungen nach einer staatlichen Aufsicht über Internet Ressourcen bislang zurückgehalten. Para. 104 des Zero Draft setzt sich ausdrücklich für ein offenes, freies und globales Internet ein und „reject models of a state-controlled or fragmented Internet architecture.“ Am 25. September 2025 traf der stellvertretende russische Außenminister Verschinin mit den UN Tech Envoy, Amandeep Gil Singh, und ITU-Generalsekretärin Doreen Bogdan Martin in New York zusammen. In der Mitteilung über das Treffen heißt es, das Russland sich einsetzen wird „in a constructive manner for carrying out the resolutions of the WSIS and for bridging the digital divide“.[34]
V. Digitalsteuer und Zölle
Die ökonomische Dimension for Internet Governance ist im 3. Quartal 2025 wieder stärker auf die Tagesordnung zurückgekehrt. Seit mehreren Jahren wird im Kontext der G20/OECD bzw. der Welthandelsorganisation (WTO) über eine Digitalsteuer und über Zölle für den grenzüberschreitenden Datenhandel diskutiert.
a. Das Thema Digitalsteuer war nach jahrelangen Verhandlungen in der OECD/G20 beim G20 Gipfel in Rom im Jahr 2021 geklärt worden mit der Annahme des OECD/G20 Inclusive Framework (IF). Pillar 2 des auch BEPS-Agreement (Base Erosion and Profit Shifting) genannten Vertrages sah eine Mindestbesteuerung von 15 Prozent für Tech Konzerne vor. Noch unter der ersten Trump Administration hatten 2020 die USA kurzeitig die Verhandlungen verlassen. Die Biden Administration war später an den Verhandlungstisch zurückgekehrt und hatte schließlich dem BEPS-Agreement zugestimmt.
- Im Februar 2025 hatten die USA unter den neuen Trump Administration erklärt, dass sie jedwede Regulierungen, die amerikanische Tech Konzerne benachteiligen, nicht akzeptieren.[35] In einem Memorandum „Defending American Companies and Innovators From Overseas Extortion and Unfair Fines and Penalties“ wurden auch Gegenmaßnahmen angedroht.
- Die G7 Staaten haben daraufhin versucht einen Kompromiss zu finden der einerseits das „Inclusive Framework“, dem mittlerweile 136 Staaten angehören, am Leben erhält, andererseits den USA Zugeständnisse macht. Der Vorschlag vom 28. Juni 2025 ist eine sogenanntes „Side-by-Side“ Modell mit Ausnahmen für US-Unternehmen (‘side-by-side’ solution under which U.S. parented groups would be exempt from the Income Inclusion Rule (IIR) and Undertaxed Profits Rule (UTPR) in recognition of the existing U.S. minimum tax rules to which they are subject). Die G7 hofft, dass dieser Kompromiss beiträgt zu einem konstruktiven Dialog über Steuern in der Digitalwirtschaft und die Sicherhung der Steuerhoheit von souveränen Staaten.[36]
- Die Reaktionen der anderen G20 Mitglieder fielen unterschiedlich aus. Im August 2025 initiierten vor allem Entwicklungsländer im Rahmen der UNO einen neuen Verhandlungsstrang zum Thema globale Digitalsteuer.[37] Ziel ist eine UN Framework Convention on International Tax Cooperation. Das neu gegründete International Negotations Committee (INC) traf sich im August 2025 zu seinen ersten zwei Sitzungen in New York und identifizierte Themen und Prioritäten. Eine dritte Verhandlungsrunde ist für November 2025 in Nairobi angesetzt. 2026 sollen drei weitere Runden in New York und Nairobi folgen. Die Konvention soll bis Ende 2027 fertig sein.
- Bei der Sitzung der G20 Finanzminister in Südafrika (KwaZulu-Natal) am 18. Juli 2025 wurde versucht, den Konflikt herunter zu spielen. Die Abschlusserklärung unterstützt nach wie vor die Umsetzung des Inclusive Framework (IF) mit dem BEPS-Agreements, nimmt aber Notiz von den beginnenden Verhandlungen im Rahmen der UNO. Die von den G7 vorgeschlagenen Ausnahmeregelungen für US Tech Konzerne werden in dem Statement ignoriert und finden keine Erwähnung. “We also welcome discussions to enhance the effectiveness and inclusivity of the IF. We note the ongoing negotiations to establish a United Nations Framework Convention on International Tax Cooperation.“ [38]
b. Das Thema Zölle auf grenzüberschreitenden Handel mit digitalen Dienstleistungen ist seit Ende der 90er Jahre anhängig. Basierend auf einem Vorschlag der damaligen US-Administration unter Bill Clinton war ein Moratorium vereinbart worden, keine Zölle zu erheben. In den 2010 Jahren forderten immer mehr Entwicklungsländer, dieses Moratorium zu beenden. Sie versprachen sich davon zusätzliche Einnahmen.
- 2019 ergriffen 79 Staaten am Rande des Davoser Weltwirtschaftsforum (WEF) eine „Joint Initiative“ zur Aufnahme von Verhandlungen zu „trade-related aspects of electronic commerce“ mit dem Ziel einer permanenten Regelung (Digital Data Trade Pact).[39] Ziel sollte sein, den Grundgedanken des Moratoriums, einen freien Fluss von Datendienstleistungen zu ermöglichen, zu erhalten und dabei spezifische Interessen der Entwicklungsländer zu berücksichtigen. An den Verhandlungen im Rahmen der WTO beteiligten sich über 90 Regierungen.
- Im Juli 2024 verkündeten die Verhandlungsführer aus Singapur, Japan und Australien, das wesentliche Teile des Abkommens ausgehandelt seien.[40] „After five years of negotiations under the WTO Joint Statement Initiative on Electronic Commerce, participants have reached a new phase, achieving stabilised text on the attached Agreement on Electronic Commerce that reflects a balanced and inclusive outcome.“ Der Plan war, das Abkommen noch vor der nächsten WTO-Ministerkonferenz/MC14 (März 2026 in Yaounde/Kamerun) zu unterzeichnen. Die Verhandlungen sind nun wieder ins Stocken geraten. Das Moratorium, das durch den neuen Vertrag ersetzt werden soll, endet am 31. Dezember 2026. Bei einem WTO-Meeting am 25. September 2025 in Genf[41] versicherte der jamaikanische Botschafter Richard Brown, Facilitator des „WTO-Work Programme on Electronic Commerce“, dass ein greifbares Ergebnis „for the stability and development of digital trade“ eine Priorität für MC14 bleibt.
[1] https://publicadministration.desa.un.org/sites/default/files/2021-04/2025/WSIS%2B20_ElementsPaper_20June.pdf
[2] https://publicadministration.desa.un.org/sites/default/files/2021-04/2025/WSIS%2B20_ZERO_DRAFT.pdf
[3] https://publicadministration.desa.un.org/wsis20/PreparatoryProcessRoadmap
[4] http://en.kremlin.ru/supplement/6376
[5] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2025-0190_EN.html
[6] https://www.youtube.com/watch?v=7v0I5eAs-14
[7] https://docs.un.org/en/A/RES/79/325
[8] https://press.un.org/en/2025/sgsm22839.doc.htm
[9] https://intgovforum.org/en/content/igf-policy-network-on-ai
[10] https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/07/Americas-AI-Action-Plan.pdf
[11] https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xw/zyxw/202507/t20250729_11679232.html
[12] https://www.techpolicy.press/the-us-aims-to-win-the-ai-race-but-china-wants-to-win-friends-first/
[13] http://www.brics.utoronto.ca/docs/250706-ai.html
[14] https://www.soumu.go.jp/hiroshimaaiprocess/en/index.html
[15] https://g7.canada.ca/assets/ea689367/Attachments/NewItems/pdf/g7-summit-statements/ai-en.pdf
[16] https://www.g7.utoronto.ca/employment/2024-declaration.html
[17] https://meetings.unoda.org/meeting/57871/documents
[18] https://conf.unog.ch/digitalrecordings/en/clients/61.0500
[19] https://docs.un.org/en/A/HRC/60/63
[20] https://docs.un.org/en/A/80/257
[21] https://documents.unoda.org/wp-content/uploads/2022/03/The-UN-norms-of-responsible-state-behaviour-in-cyberspace.pdf
[22] https://unidir.org/files/2019-10/GGE-Recommendations-International-Law.pdf
[23] https://poc-ict.unoda.org/
[24] https://docs.un.org/en/A/79/88
[25] https://press.un.org/en/2025/sgsm22643.doc.htm
[26] https://reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/ccw/2025/gge/statements/5Sept_Group.pdf
[27] https://www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/convention/text/convention-full-text.html
[28] https://hanoiconvention.org/
[29] https://docs.un.org/en/A/HRC/60/63
[30] https://mid.ru/en/foreign_policy/international_safety/2006373/
[31] https://www.itu.int/md/S25-RCLINTPOL22-C/en
[32] https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/PR-2024-06-05-pp26.aspx
[33] https://docs.un.org/en/A/AC.292/2025/INF/5/Rev.1
[34] https://mid.ru/en/foreign_policy/news/2048719/
[35] https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/02/defending-american-companies-and-innovators-from-overseas-extortion-and-unfair-fines-and-penalties/
[36] https://www.g7.utoronto.ca/finance/250628-tax-statement.html
[37] https://financing.desa.un.org/unfcitc
[38] https://www.g20.utoronto.ca/2025/250718-finance-communique.html
[39] https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/L/1056.pdf&Open=True
[40] https://www.wto.org/english/tratop_e/ecom_e/joint_statement_e.htm
[41] https://www.wto.org/english/news_e/news25_e/ecom_25sep25_e.htm